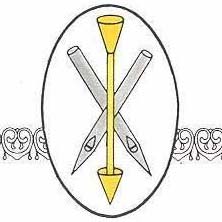

Altösterreichischer Orgelbau
gestern und heute
Peter Maria Kraus
gestern und heute
Peter Maria Kraus
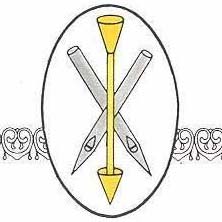
|
gestern und heute Peter Maria Kraus |
